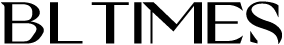Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Beraterin oder Ihren Berater telefonisch oder per Secure Mail zu kontaktieren, oder vereinbaren Sie für ein persönliches Gespräch zuvor einen Termin.
Aus gegebenem Anlass empfehlen wir derzeit die Kontaktaufnahme per Telefon oder über unsere gesicherten digitalen Kanäle. Für ein persönliches Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater bitten wir Sie um vorherige Terminabsprache.
Philanthropie: Die Rendite der Großzügigkeit
Privatbankiers sollten sich auch dafür interessieren, auf welche Weise ihre Kunden ihr Vermögen ausgeben möchten. Anlagen mit philanthropischer Zielsetzung sind hier nicht zu unterschätzen: Sie werden vom Kunden reiflich bedacht und sollen in der Regel eine „soziale Rendite“ erzielen. Philippe Depoorter von der Banque de Luxembourg geht in der belgischen Tageszeitung L‘Echo/De Tijd näher auf das Thema ein.
„Philanthropie muss intelligent gemacht sein. Die Zeiten sind vorbei, als man eine Spende für einen guten Zweck machte in der Hoffnung, das Geld ,werde schon irgendetwas Gutes bewirken‘. Was für das Vermögen als ganzes gilt, gilt auch für die Philanthropie: Jeder Euro soll maximale Rendite erzielen. Dabei geht es vielleicht nicht immer nur um monetäre Rendite, sondern um sozialen Ertrag“, erläutert Tine Bourgeois, Leiterin Business Development Philanthropy bei BNP Paribas Fortis.
Wo sind die Schnittstellen zwischen dem Private Banking und der Philanthropie? Privatbankiers stehen ihren Kunden beratend zur Seite, wenn diese mit ihrem Vermögen einen guten Zweck verfolgen möchten. Das Interesse an der Philanthropie nimmt stetig zu: nicht nur bei älteren Menschen, die keine Erben haben, sondern auch bei Kunden in den Vierzigern, die z. B. ihr Unternehmen verkauft haben. „In diesen Fällen gehört die Philanthropie zu unserem Standardangebot, und die meisten Kunden denken tatsächlich darüber nach“, unterstreicht Bourgeois. „Nicht immer führt das zur Unterstützung eines konkreten Projekts. Viele möchten lieber unverbindlich spenden oder laufende Projekte, z. B. von Freunden, unterstützen.“
Philippe Depoorter, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter der Philanthropieberatung bei der Banque de Luxembourg, hat die gleiche Erfahrung gemacht. Doch er schränkt ein: „Man muss realistisch sein: Der Anteil der Kunden, der über Jahre hinweg größere Summen für philanthropische Projekte aufwendet, ist letztlich sehr begrenzt.“
Und wohlhabende Kunden, die regelmäßige Zuwendungen an gemeinnützige Vereinigungen machen, suchen nicht unbedingt den Rat ihres Bankiers. Doch diejenigen, die einen Schritt weiter gehen möchten, um eine größere Wirkung zu erzielen, können sich an ein auf Philanthropie spezialisiertes Team wenden, so Silvia Steisel von Banque Degroof Petercam. „Kunden sehen die enormen Defizite unserer Gesellschaft und erwarten von uns Orientierung in der Welt der Philanthropie, die ihnen oft unbekannt ist und vielleicht etwas undurchsichtig erscheint.“
„Bevor wir diesen Service auflegten, haben wir uns gefragt, ob sich ein Bankier in diesem Bereich beratend einbringen sollte“, erinnert sich Depoorter. „Traditionell ist es ja unsere Aufgabe, das Vermögen unserer Kunden zu schützen und wachsen zu lassen - und nicht dabei zu helfen, es auszugeben. Doch wir waren und sind der Ansicht, dass uns unsere Rolle als Vertrauensperson in der Finanzverwaltung für unsere Kunden uns hierzu berechtigt. Oft ist es einfacher, das Thema der Philanthropie in diese Beziehung mit hinein zu nehmen, als die Finanzlage des Kunden noch einmal neu vor einem Dritten auszubreiten. Außerdem muss das philanthropische Projekt ja zur gesamten Vermögensverwaltung des Kunden passen.“
Profil
Eine Gemeinsamkeit aller Berater ist, dass in einem ersten Schritt ein Spenderprofil erstellt wird. „Meist hat der Kunde, der tätig werden möchte, nur vage Vorstellungen von dem Zielbereich, wie z. B. Bildung oder Gesundheit“, beobachtet Steisel. „Wir setzen dann weiter vorne an: Welche Ziele verfolgt der Kunde? In welchem Umfang möchte er Mittel investieren?“ „Wir müssen den Blick des Kunden zunächst erweitern, um ihn anschließend wieder enger zu fassen“, ergänzt Depoorter. „Oft ist dem Kunden ein Thema ein Anliegen, das mit seiner persönlichen Situation zusammenhängt: Die Förderung der medizinischen Forschung wäre hier ein typisches Beispiel, vor allem bei Menschen, die sich deshalb für Philanthropie interessieren, weil sie keine Erben haben. Unsere Aufgabe ist dann zu besprechen, was mit ihrem Erbe geschehen soll. Die Frage kann für den Betroffenen ein heikles Thema sein, denn sie führt ihm die eigene Endlichkeit vor Augen.“
Wenn die Ziele umrissen sind, müssen der Umfang und die Art bzw. der Ablauf der Zuwendung geklärt werden. Noch einmal Steisel: „An dieser Stelle analysieren wir den Markt: Welche Angebote gibt es bereits? Welche Modelle haben in der Vergangenheit nicht funktioniert? Wo sind erfolgversprechende Konzepte zu finden? Gibt es noch andere Parameter, die eine Rolle spielen?“ Bei BNP Paribas Fortis können Kunden eine große Datenbank nutzen, in der mögliche Projekte gesammelt sind.“ Die Berater kennen die Vor- und Nachteile der einzelnen Projekte und helfen dem Kunden gegebenenfalls, eine Entscheidung zu treffen. „So fließen zum Beispiel beim UN-Kinderhilfswerk UNICEF die Gelder, die das jeweilige Regionalkomittee nicht abruft, nach einem Jahr an die Dachorganisation zurück. Wenn Sie Ihr Geld unbedingt lokal anlegen möchten, ist dies wichtig zu wissen“, erläutert Bourgeois.
Doch nicht alle Bankiers sehen ihre Aufgabe so weit gefasst: In der Banque de Luxembourg ist es Grundsatz, nicht so weit zu gehen: „Wir äußern uns nicht über die Qualität einer Organisation im Vergleich zu einer anderen, und wir geben keine Bewertung der jeweiligen Projekte ab. Da halten wir nicht für unsere Aufgabe.“
Strukturierung
Der Philanthropie-Berater untersucht anschließend zusammen mit dem Kunden die geeignete Strukturierung. Viele Kunden möchten sich bewusst in eine bestehende Initiative einbringen. Zusammenarbeit und Networking sind heute wichtiger als früher. Auch wenn ein Kunde zunächst die Idee hat, seine eigene Stiftung aufzulegen, ist dies nicht zwangsläufig die beste Lösung:
„Natürlich kann man seine eigene Stiftung gründen“, erläutert Bourgeois.„Doch das ist nicht so einfach:Die Gründung muss vor einem Notar erfolgen, dann muss eine jährliche Bilanz vorgelegt werden. Wenn sich der Kunde dennoch für diese Lösung entscheidet, wird ihn die Bank dabei unterstützen.“ Als Lösung „light“ ist die Auflegung eines Fonds möglich, der im eigenen Namen mit ausdrücklich festgelegtem Ziel aufgelegt und von Dritten verwaltet wird. In Belgien läuft die Verwaltung in der Regel über die Fondation Roi Baudouin. „Diese Lösung wird sehr häufig genutzt, und mit der Fondation Roi Baudouin kann man bereits ab einer Summe von 75.000 Euro zusammenarbeiten,“ erläutert Bourgeois. Anschließend ist zu entschieden, ob man einen zeitlich befristeten Fonds auflegen möchte, bei dem das Kapital schrittweise aufgezehrt wird, oder einen unbegrenzten, bei dem nur die Zinsen verwendet werden. Auch die Frage nach dem Umfang des Engagements des Kunden stellt sich.
Privates Kapital, das im großen Umfang für philanthropische Zwecke mobilisiert wird, bleiben dabei die Ausnahme. Welches Serviceangebot im Einzelnen genutzt werden kann, hängt vom betreffenden Kapitalstock ab: Wer zum Beispiel einmalig 75.000 bis 100.000 Euro investieren möchte, wird bei der Festlegung des Anlageziels beraten und kann das Know-how von Private-Banking-Experten in Bezug auf Organisationen und Projekte nutzen.
Soziale Wirkung
Bei umfangreicheren Projekten unterstützt die Bank den Kunden auch bei der fortlaufenden Beobachtung des Projekts. Philanthropische Anleger möchten heute wissen, ob ihr Geld auch wirklich etwas bewirkt. Sie möchten sicherstellen, dass es so effizient wie möglich eingesetzt wird. „Unsere Strategie im Bereich sozialer Investments ist dieselbe wie die, die wir für das gesamte Portfolio anwenden“, erklärt Steisel. „Die eingesetzten Gelder werden strukturiert, verwaltet und alljährlich optimiert und evaluiert. Sie erhalten dieselbe Aufmerksamkeit wie das übrige Portfolio, manchmal sogar noch mehr: Wir stellen oft fest, dass sich Kunden am meisten für das interessieren, was ihnen am Herzen liegt und was für sie langfristig von Bedeutung ist.
Heute erwarten Philanthropen auch von den Vereinigungen und Initiativen mehr Transparenz in Bezug auf die Verwendung der Gelder und die erzielten Ergebnisse. Noch einmal Bourgeois: „Das Motto der Philanthropen ist heute: ,Doing good and doing it better.‘Die Forderung nach Transparenz und Wirkung nimmt immer mehr zu. Der Spender möchte wissen, ob seine Spende etwas bewirkt hat.“
Den Zuwendungsempfängern fordert dies eine höhere Rechenschaftspflicht ab; sie müssen lernen, aus ihrer „stillen Ecke“ herauszutreten. „Die Transparenz nimmt zu“, beobachtet auch Bourgeois. „Manche Organisationen arbeiten bereits mit klar definierten Zielen und gewährleisten ein fortlaufendes Monitoring. Ich persönlich denke, dass alle Organisationen diese Arbeitsweise übernehmen müssten, wenn sie ihren langfristigen Erfolg sichern wollen.“
Familienvermögen
Eine andere Kundengruppe sind große Familien, die ihre eigene Philanthropie- Erfahrung und Tradition mitbringen, die oft bereits ihre eigene Stiftung haben und ihren Ansatz überprüfen lassen möchten. Die sich die Frage stellen lassen möchten: Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Sind wir bzw. ist unsere Arbeitsweise noch aktuell? Diese Fragen kommen vor allem dann auf den Tisch, wenn die Familie die nachfolgende Generation an den philanthropischen Aktivitäten beteiligen möchte. Die Frage ist dann, wie dieses Engagement an die Kinder weitergegeben werden kann. Sollen sie bei der Verwaltung der Familienstiftung eine verantwortliche Rolle übernehmen? Muss die Funktionsweise oder die Zielsetzung der privaten Stiftung vielleicht an die Anliegen der jungen Generation angepasst werden. Nicht immer will diese die „guten Werke der Vätergeneration“ unterstützen.
Umfragen zeigen, dass die junge Generation neue Formen der Philanthropie sucht, wie zum Beispiel Social Economy oder Impact Investing. So beispielsweise durch die Gründung eines Kleinunternehmens, das schwer vermittelbaren Menschen Arbeit gibt und das die Geldmittel der Stiftung möglichst durch eigene Einkünfte - z. B. durch die Herstellung eines Produkts - ergänzt.
„Die Kinder in die Philanthropie einzubeziehen, ist eine Lebensschule: Sie zeigt, dass sich die Schaffung von Wert nicht unbedingt in barer Münze auszahlen muss“, , fährt Depoorter fort.„Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, dass es eine nicht zu unterschätzende Geste ist, einen Teil des Familieneinkommens für philanthropische Zwecke einzusetzen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man sich von einem Teil des Geldes trennt, das normalerweise an die junge Generation gehen würde. Und man muss die Entscheidung idealerweise gemeinsam tragen. Eine Familie, die sich für Philanthropie einsetzt, muss sich Zeit nehmen, um ihren Ansatz und die Zielsetzung ihres Projekts zu besprechen. „Nicht selten ist das ein Prozess von zwei oder mehr Jahren.
Doch diejenigen, die sich darauf einlassen, gewinnen daraus ein hohes Maß an Befriedigung“, unterstreicht Bourgeois. „Wir haben zum Beispiel Kunden, die uns sagen: ,Das ist die beste Rendite, die ich mit meinem Geld jemals erzielt habe.‘“
Quelle: L'Echo/De Tijd vom 31. Mai 2017, Dossier Private Banking