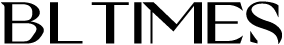Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Beraterin oder Ihren Berater telefonisch oder per Secure Mail zu kontaktieren, oder vereinbaren Sie für ein persönliches Gespräch zuvor einen Termin.
Sich neu erfinden nach der Krise
Die Corona-Krise hat in vielen Wirtschaftszweigen unmittelbare Schäden verursacht, deren Folgen noch lange zu spüren sein werden. Um darüber nachzudenken, wie sich lokale Unternehmen für die Zukunft rüsten können und welche Chancen Luxemburg bietet, veranstaltete das Magazin Paperjam am 14. Januar 2021 eine Podiumsdiskussion.
Zu den Teilnehmenden gehörte auch Pierre Ahlborn, Administrateur Délégué der Banque de Luxembourg. Zusammen mit den anderen Podiumsteilnehmern, die sich wie er mit den Themen Resilienz und Wiederaufschwung der Wirtschaft im Großherzogtum befassen, diskutierte er seine Erfahrungen und Visionen für die Zeit nach der Krise.
Banken und Finanzdienstleister sind sicherlich die Branchen, die mit am besten durch diese Krise gekommen sind. Woran liegt das?
Pierre Ahlborn (P. A.): Die Resilienz der Finanzbranche hat vor allem zwei Gründe: zum einen die schnelle Umstellung auf Homeoffice, mit der Störungen der Geschäftsabläufe vermieden werden konnten; zum anderen aber auch das Bewertungsniveau der Aktienmärkte: Trotz ihrer hohen Volatilität haben die Börsen das vergangene Jahr auf ordentlichen Bewertungsniveaus beendet. Bei den Fintechs haben insbesondere die Anbieter von Zahlungsdienstleistungen vom boomenden Online-Handel profitiert. Insgesamt präsentierte sich die Branche widerstandsfähig, auch wenn manche kleinere Unternehmen darunter litten, dass andere angesichts der unsicheren Gesamtlage ihre Investitionen oder Kooperationen aufgeschoben haben.
Es wird erwartet, dass sich die Krise 2022 auch in den Bilanzen der Banken niederschlagen wird. Wie bereiten sich die Finanzhäuser darauf vor?
P. A.: Wir hoffen, dass das nicht der Fall sein wird! Tatsächlich wird weltweit diskutiert, ob nach der Krise eine Welle an Unternehmenspleiten zu einer Finanzkrise führen wird. Seit 2008 besitzen die Banken, insbesondere im Norden Europas, solide Bilanzen, und auch die Risikokontrolle funktioniert besser. Vor allem stellt man fest, dass nur wenige Unternehmen aufgrund der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Sie wurden vom Staat unterstützt und von den Banken mit ausreichend Liquidität versorgt. Uns verbinden dieselben Interessen, und die Banken werden alles tun, um die Unternehmen zu unterstützen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass den Banken bei der Risikokontrolle eine große Verantwortung zukommt, damit es nicht zu einer „Krise nach der Krise“ kommt. Die luxemburgische Finanzaufsichtskommission und die Europäische Zentralbank wollen sicherstellen, dass die Bankenbranche in den kommenden Jahren nicht zum Problem wird. Wir haben die Pflicht, nur diejenigen Unternehmen zu finanzieren, die eine echte Überlebenschance haben. Auch wenn dies bislang gut funktioniert hat, muss man sich darüber klar sein: In den kommenden vier Jahren werden manche Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, weil sie durch die Krise geschwächt wurden.
Schauen wir nach vorne: Wie kann die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen?
P. A.: Ich möchte drei Lektionen nennen, die uns die Krise lehrt: Zunächst einmal hat sie bereits bestehende Tendenzen verstärkt – vor allem, die Digitalisierung der Wirtschaft. Zum zweiten hat uns die Krise dazu gebracht, neue Arbeitsformen und -modelle zu testen, die die Produktivität beeinflussen – allen voran das Homeoffice. Und drittens glaube ich, dass wir nach dieser Krise einen kräftigen Produktivitätsschub in den Unternehmen erleben werden. Man musste darüber nachdenken, wie man arbeitet und seine Leistungen anbietet – das wird sich auszahlen. Vielleicht kann diese Krise also den Produktivitätsschub auslösen, auf den wir schon so lange warten.
Welche Lehren würden Sie aus der Krise ziehen?
P. A.: Zunächst ist niemand für die Krise verantwortlich zu machen; sie war und ist einfach sehr ungerecht für Menschen und für Unternehmen. Sie hat Solidarität erfordert. Und in unserem Gesellschaftsmodell gilt der Staat als wichtigster Träger von Solidarleistungen. Um diese Solidarität zu ermöglichen, mussten wir Schulden aufnehmen. Ich hoffe, dass es dann, wenn es an den Abbau dieser Verschuldung geht, zu einer gerechten Verteilung der Lasten kommen wird. Zu hoffen ist auch, dass diese Krise nicht nur in der digitalen Entwicklung einen Wendepunkt markiert, sondern auch in unserem ökologischen Bewusstsein und Handeln. Auch wenn es einige Zeit dauern wird: Wenn man die Investitionstätigkeit fördern will, ist es genau der richtige Weg, in Infrastrukturen zu investieren, die wir alle brauchen,